
Hauptseite

Projekte

Personen

Bilder

Hintergrund

Inhalt
Hans Magnus Enzensberger
Der Fliegende Robert
Eskapismus, ruft ihr mir zu, vorwurfsvoll.
Was denn sonst,
antworte
ich,
bei diesem Sauwetter! ,
spanne den Regenschirm auf
und erhebe
mich in die Lüfte.
Von euch aus gesehen,
werde ich immer kleiner und
kleiner,
bis ich verschwunden bin.
Ich hinterlasse nichts weiter als
eine Legende,
mit der ihr Neidhammel,
wenn es draußen stürmt,
euern
Kindern
in den Ohren liegt,
damit sie
euch nicht davonfliegen.
|
Die Leidinger Hochzeit
KAPITEL II
Er fügt euch nun zusammen,
läßt Mann und Frau euch sein,
einander Wort und Treue,
einander Brot und Wein.
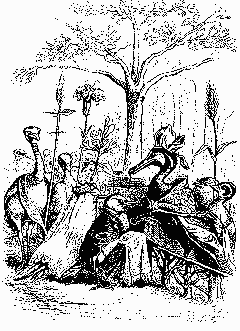
Sagt an, wer ist doch diese,
die vor dem Tag aufgeht
Ein Schlag Erinnerung. Schrill durch den
Kopf. Verkrampft bis in die Zehen. Und den Schweiß in der Hand schon
vorher. Gewartet. Wann, wann endlich. Dann aber doch immer wieder der Schreck.
Diese Peitsche, die Gänge entlang! Betonbau, viel Glas. Der Hall durch
und durch, und das Echo im Kopf sirrt nach.
Die überm Paradiese,
als Morgenröte steht
Aufstehen, raus, raus. Gestreckt. Den
Schlaf abplatzen lassen. Die Nachtgedanken abpelzen. Abschuppen die Bilder
aus Träumen.
Sie kommt hervor aus Fernen,
geziert mit Mond und Sternen
im Sonnenglanz erhöht.
Und um ihn herum die anderen verschlafenen
Gesichter. Keukel, Mock, Bibi, Pietje und Spieß, Floh, Issi, Jupp,
Beppo und Schlapp. Zunamen. Warum Pietje so und Mock Mock und Bibi weshalb?
Nur er, wie er da kniet: ehrlich, Erich, ehrlich. Und: Erich währt
am
längsten. Und: Er - ich. Icher. Sein Zuname. Seine Zunamen. Und um
ihn herum die zähen Bewegungen. Noch kein Wort. Keiner ist schon so
weit. Jeder noch ganz bei sich. Aber doch aus den Betten schon. Nur Keukel
noch fest in sein Kissen verbissen, nasser Fleck. Keukel, Keukel, wach
auf, los, mach schon, komm, los, wach auf! |
Jeden Morgen. Und dann aus dem Schlafraum
über den Gang in die Toilette oder sofort in den Waschraum. Augenhoch
die lange Spiegelwand. Vor die Waschtröge. Gebeugt. Kniet er da. Erich,
ehrlich, wie er da kniet neben ihr.
Sie ist die edle Rose,
ganz schön und auserwählt
Da schlägt der Seifen- und Zahnputzschaum
die Rinne entlang Blasen dem Abfluß zu. Dann im Spiegel: ein Nachtgesicht,
noch Schlafgesicht.
Die Magd, die makellose,
die sich der Herr vermählt
Jeanne. Ob sie sich das vorstellen kann?
Erzählen, denkt Erich, erzählen
kann man vieles. Aber so deutlich, so vor sich, wie das von damals im Konvikt.
Im bischöflichen Konvikt. Und jetzt kniet er neben ihr. Icher. Der
Lateinlehrer hatte gesagt: Erich, ehrlich, Erich. Und der Sportlehrer:
Erich währt am längsten. Der hatte es nötig gehabt. Seine
Boxernase und die dummen Anspielungen. Aber sonntags Waschmaschinen verkaufen.
Der Herr Studienrat. Icher, Icher hatte Floh ihn getauft. Icher, Icher:
Mickymausheft. Davon weiß Jeanne nichts.
O eilet, sie zu schauen,
die schönste aller Frauen,
die Freude aller Welt.
Von allen hier weiß nur Issi die
Zunamen.
Issi, der oben die Orgel spielt. Von der
Empore |
herunter hat er den Überblick. Im
Konvikt vorne links, versteckt die Orgel. Da saß Issi jeden Morgen.
Der weiß alles von da, von damals. Alles? Vieles. Icher, das weiß
er. Nur Jeanne weiß davon noch nichts. Viel Zeit werden sie haben,
Jeanne und er, Mann und Frau, zum Erzählen.
Du strahlst im Glanz der Sonne
Jetzt außer Gähnen auch schon
Lachen im Waschraum. Und die ersten Worte: Sau, du Sau. Von Spieß
zu Mock oder Pietje zu Floh, oder irgendein anderer. Issi sagt so etwas
nicht. Nie. Aber er schon. Oft. Naß gespritzt. Oder die Seife weggeschossen.
Runter die Schlafanzughose. Oder die Zahnpastatube drauf die Faust. Irgendetwas
so. Sau, du Sau! Aber, als sei ein Zauber verflogen, jetzt wird geredet.
Einmal, als Mocks Strähne, die er
immer mit Brillantine zur Tolle stupfte, weg war.
Weg, wirklich. In der Nacht hatte sie
einer abgeschnitten. Und alle schauten aus schrägen Augen auf Mock,
der dastand und in den Spiegel starrte. Lange. Nichts. Dann sagte: wer,
wer wars? Und keiner auch nur so tat, als habe er ein Wort gehört.
Und Mock aus dem Waschraum ging. Alle lachten. Bis sie im Schlafraum vor
ihren leeren Kleiderschemeln standen. Und Mock sagte: weg, einfach weg.
Und auf das Fenster hinter sich zeigte.
Maria hell und rein;
von deinem lieben Sohne,
kommt all das Leuchten dein. |
Spielt Issi oben auf der Orgel. Schrill
wieder das Läuten. Nur diesmal nicht unvorbereitet. Jetzt in Kleidern,
oft zwar in Hausschuhen noch, aber schon weit vom Schlaf. Wenn auch noch
nicht ganz aus den Träumen. Wie sie durch die Gänge schlichen.
Die falschen Marmortreppen herunter. Türenklappen. Vor allem der Laut
zurückfedernder Glastüren.
Und einmal, als Keukel, zu spät war
er dran, mitten durch eine Glastüre lief. Und die Glassplitter ihm
im Bauch steckten. Keukel der Igel mit Stacheln aus Glas ins Krankenhaus
transportiert werden mußte.
Und wie sie immer im breiten Flur neben
dem Atrium "Aufstellung nahmen". Hieß es. Alle da. Um gemeinsam in
die Kapelle zu schlurfen.
Durch diesen Glanz der Gnaden
sind wir aus Todes Schatten
kommen zum wahren Schein.
Ob sie das verstehen wird, diese vielen
Morgen im Konvikt. Zur Messe gehen. Knien. Jeanne. Er wird es ihr zu erklären
versuchen. Daß ihn der Geruch der Kapelle, Kerzen, Weihrauch, gebohnerter
Boden dazu gebracht, daß er vom Licht durch die bunten Fenster, dunkelrot,
blau, gedrängt, oder auch schon vom so ganz anderen Geräusch
der Schritte in diesem Raum darauf gestoßen worden war, daß
das Lied, dieses Lied, das Issi spielt, das alle singen, ihn gepackt, daß
er sich nicht |
hatte wehren können gegen diese Bilder.
Wenn sie sich durch den Hauptgang der Kapelle drückten. In die Bankreihen
schoben. Jeder an seinen festen Platz, der schuljahreweise nach hinten
wechselte, "bis sie die Reife hätten, aus der Kapelle aus dem Haus
in das Leben hinaus" ...
Die Stimme. Erich hört sie. Hat sie
im Ohr jetzt. Fest, geht sie nicht weg. Sitzt sie im Ohr. Diese Stimme
des Herrn Konviktsdirektors. Die, wenn er vorbetete, sang, predigte, unberechenbar
wurde. Für ihn. Für alle. Riß in die Höhe, brach.
Ein Raunzen, ein Jaulen. Als hätten Vokale und Konsonanten, die Silben,
die Wörter Angst vor seiner Stimme, von ihm gesprochen zu werden,
krümmten sie und bogen sie sich, zogen sich und fielen zusammen. Wurden
gepreßt, gestoßen, mit Speichel genäßt, geschoben,
verschluckt. Mitleid. Als hätte der Herr Konviktsdirektor Mitleid
nötig gehabt. Nein, nein, nur jetzt nicht, nicht hier daran denken.
Auch das, von diesem Haß, seinem Haß auf den Herrn Konviktsdirektor
wird er Jeanne erzählen. Muß sie wissen
Die Braut singt mit. Nicht einmal hat
sie in das Gesangbuch schauen müssen. Mai. Marienmonat. Wie lange
es her ist, daß sie ein Marienkind war ... Warum Erich nicht mitsingt?
Kniet neben ihr, stur, ohne zu singen. Das Gesangbuch aber aufgeschlagen
in seiner Hand. Nur, wohin er schaut. Geradeaus. Sieht sie von der Seite.
Bewegt die |
Augen nicht, schaut sie nicht
an. Träumt weg. Erich, woran er jetzt denkt, denkt sie. Hört
auf zu singen und sieht sich, wie sie vor der Maiandacht Schlüsselblumen
zur
Grotte der heiligen Maria neben der Kirche bringt. Oft hat sie beiden,
der auf der deutschen und der heiligen Jungfrau Maria auf der französischen
Seite Blumen hingestellt.
Sei gegrüßt
o Königin, Mutter der Barmherzigkeit,
unser Leben, unsre Wonne, unsre Hoffnung,
sei gegrüßt
Wie oft hat sie so gebetet, dabei geweint,
heimlich, wenn es ihr allzu schwer geworden ist, und sie hat wegwollen.
Zu dir rufen wir,
verbannte Kinder Evas;
Zu dir seufzen wir,
trauernd und weinend
in diesem Tal der Tränen.
Aber heute ist ihr Freudentag. Auch wenn
im Augenblick Erich sie nicht anschaut. Erich. Jeanne Hautz wird sie nicht
heißen. Erich will das so. Den Doppelnamen: Jeanne Beaumont-Hautz.
Sie hat nichts dagegen. Obwohl, dieser Name wird Stolperstein sein. Beaumont
für die einen, für die anderen Hautz. Das weiß sie. Macht
ihr aber nichts aus. Der Stolperstein. Das war sie immer schon. Rote Haare
Sommersprossen. Auch da: die Gebete. O Maria hilf! |
Unter deinen Schutz und Schirm,
fliehen wir, heilige Gottesgebärerin
Und wie sie immer hat lachen müssen
an dieser Stelle, aber so, daß keiner es merkte - beim Beten lachen!
- in der Kirche, zuhaus, bis heute noch lachen muß: Schutz und Schirm.
Wie er davon fliegt, ihr Bruder. Robert. Wie sie ihm die Verse unter die
Nase gerieben, wenn er sie wieder einmal Karottenkopf geschimpft hatte
oder Schlimmeres: Seht den Schirm erfaßt der Wind,
und der Robert fliegt geschwind,
durch die Luft so hoch so weit,
niemand hört ihn, wenn er schreit.
Und hier Roberts Wut meist schon so war,
daß er entweder auf sie zustürzte, oder später, als er,
älter, das nicht mehr tat, Mädchen schlagen, aus dem Zimmer lief,
nicht mehr die anderen Zeilen hören konnte:
Schirm und Robert fliegen dort
durch die Wolken immerfort.
Und der Hut fliegt weit voran,
stößt zuletzt am Himmel an.
Du Pforte des Himmels,
du Morgenstern,
du Heil der Kranken,
du Trösterin der Betrübten
Ob sie fromm ist? Daß sie daran
glaubt? Geholfen hat es ihr. Immer wieder. Das hat sie Erich geantwortet.
Nicht Jeanne d'Arc, die heilige Johanna, |
die Jungfrau von Orleans. Zu ihr hat sie
nie beten können. Mit ihr hat sie kämpfen wollen, siegen. Jemand
werden, berühmt: Jeanne Beaumont. Wie die heilige Johanna in den Flammen
aufglühen, vergehen. Das hat sie sich oft vorgestellt. Hier in der
Kirche. Wenn sie auf die Bilder hinter dem Altar starrte. Und es sie heiß
überlief. Durch die Flammen auffahren in den Himmel. Aber beten, sich
ihr anvertrauen, sie bitten, von ihr Hilfe erhoffen, das war nicht Jeanne
d'Arc, das war Maria. Wenn sie nicht mehr ein noch aus gewußt hat:
Nur weg, weg hat wollen, weg von hier. Aus dem Dorf. Die nahe Kleinstadt
hat ihr schon geholfen, sie mit Isabelle zusammengebracht, der sie alles
anvertrauen kann. Ab dann hat sie nicht mehr soviel zu beten, zu bitten
gehabt. Bis heute hat sie jemanden, dem sie vertraut. Der fast alles von
ihr weiß. Den zu verlassen ihr am schwersten fallen wird. Denn weg
will sie. Weg wird sie gehen. Dafür kämpft sie. Wie ihre Namenspatronin.
Mit Feuer, mit Schwert. Gegen wen, gegen jeden. Auch Erich.
Als könnte sie ihm die Träume
verscheuchen, hebt sie die Hand, daß er sie bemerkt, streicht sie
sich über die Stirn. Auch gegen ihn würde sie kämpfen, nur
weg zu kommen. Und darauf baut sie: daß ihre Hochzeitsreise dorthin,
wo Erich jahrelang war, in die Großstadt, daß diese Reise mehr
wird als das. Dort bleiben. Mal sehen, hat Erich gesagt. Sie |
sieht sich schon dort mit ihm wohnen.
Wie sie dort leben. Wenigstens für eine längere Zeit. Darum bittet
sie. Will sie kämpfen. Dafür betet sie.
Heilige Gottesgebärerin,
Heilige Jungfrau über allen Jungfrauen,
Mutter Christi,
Mutter der göttlichen Gnade
Das fällt ihr immer noch schwer,
obwohl sie es herbeten kann:
Du reine Mutter,
du keusche Mutter,
du unversehrte Mutter,
du unbefleckte Mutter,
du liebenswürdige Mutter,
du wunderbare Mutter
Obwohl ihre Mutter, nein, weil ihre Mutter
Marie heißt? Und sich zwischen sie und die Mutter der Fürbitten
und der Gebete immer die Bilder, wie sie sich mit ihrer Mutter streitet,
schieben. Schwer, Mutter, Mutter Gottes, heilige Mutter Maria zu beten,
ohne Marie, ihre Mutter, nicht auch mit zu meinen. Daß einem die
Hände abfallen, wenn einer so betet, hat sie als Kind immer geglaubt.
Aber trotzdem oft in ihren Gebeten die Bitte, Waise zu sein, allein, ganz
allein auf der Welt. Niemanden sonst mehr zu haben. Den Bruder nicht, den
Vater nicht, obwohl sie Jacques, ihren Vater, mag, keine Mutter, vor allem
das. Und dieses Gefühl, Waise zu sein, ganz ohne jeden! Meist vor |
dem Schlafengehen Gebete mit dieser Bitte.
Weich im Selbstmitleid dann in den Schlaf.
Heute, Isabelles Tochter Jacqueline nach
dem Autozusammenstoß im Arm, hat sie sich daran erinnert. Waisenkind,
Waisenkind. An sich selbst aber dabei gedacht. Ihr sind die Hände
nicht abgefallen, verfault. Sie hat beide Hände noch. Schiebt jetzt
die eine zu Erich hinüber. Berührt ihn. Tupft ihn sanft an. Wieder.
Da zuckt er zusammen. Nie Kinder erschrecken, wenn sie mit offenen Augen
träumen, denkt sie und lächelt zurück. Jetzt ist er wach.
Wieder da. Und betrachtet sie. Spürt sie. Erich. Das ist ihr Glückstag
heute. Bald wird sie sein, wohin sie immer hat wollen.
Du Ursache unserer Freude,
du geheimnisvolle Rose,
du starker Turm Davids,
du elfenbeinerner Turm,
du goldenes Haus.
Dank dir, Maria. Maria hat ihr geholfen.
Das wird sie ihr nie vergessen. Nie nie nie! Würde sie am liebsten
laut rufen. Hinausschreien ihr Glück.
Gut, sehr gut spielt er. Der macht was
aus seiner Orgel. Aber hatte nicht Erich zu ihm gesagt, es käme einer,
der verstehe etwas von Orgeln. Musiker sei der mit Leib und Seele. Der
habe schon im Konvikt die Orgel bedient. Der spiele nicht Musik, der lebe
sie. So einen müßte er hier haben. Sagt sich Pastor Claude Vigy.
Hier im Dorf. Aber, |
| wer bleibt schon hier. Erich, das ist
eine Ausnahme. Da haben auch fast alle gesagt: wie kann er nur. Von da,
aus der Großstadt wieder zurückkommen. Und so ganz kann er das
auch nicht begreifen. Glaubt es auch noch nicht. Da kennt er Jeanne Beaumont
zu gut. Jeanne will weg. Das hat sie ihm zu oft gesagt. Und Erich, mit
Erich ginge es. Wie die Orgel klingt! So hat er sie schon lange nicht mehr
gehört. Das hätte er denen nicht zugetraut, als er sie mit dem
Ziehwägelchen zur Kirche hinauf hat kommen sehen. O Gott, hatte er
gedacht, da komme was auf ihn zu. Und für einen Augenblick hatte er
an Erich gezweifelt. Aber jetzt, der bringt die Orgel zum Singen! Daß
die Orgel ein Juwel sei, sehr alt, aus einer anderen Kirche hierhergebracht,
haben sie ihm damals gesagt, als er hier Pastor geworden ist. Elf Jahre
her ... Und noch nicht alle haben es ihm verziehen, daß er in seiner
Antrittspredigt hatte einfließen lassen, 33 sei er gerade geworden.
Ein Alter, in dem man Jesus gekreuzigt, ihn aber hierher versetzt habe.
Da hatten manche aus der Gemeinde Schlüsse gezogen. Daß sie
nicht mehr zu seinen Gottesdiensten kamen. Auf deutscher Seite in die Kirche
gingen. Aber mit der Zeit, vor allem durch Gespräche, hatte sich das
wieder eingerenkt. Die Gespräche mit den Leuten im Dorf haben ihm
geholfen, in die Gemeinde langsam hineinzuwachsen. Den Leuten näher
zu kommen. |
Den Weg zu ihnen zu finden, daß
sie den Weg zu ihm fänden. Aber wie oft, wenn er am Abend aus seinem
Küchenfenster über das Dorf, die zwei Dörfer, schaut, fällt
ihn der Zweifel an. Mit jemandem darüber sprechen ... Sein Lieblingsbuch
im Seminar: Tagebuch eines Landpfarrers. Hätte er sich damals denken
können, aufs Land versetzt, nicht einmal den Trost eines Amtsbruders
in der Nähe zu haben, dem er sich mitteilen könnte ... Aussprechen,
was manchmal vorgeht in einem. Was ihn bedrückt. Der Lehrer, anfangs
hatte er gedacht, das sei jemand, dem könne er sich anvertrauen. Aber
zu skeptisch ist der gewesen. Auch zu sehr in sich selbst. Schon beim Vortasten
hatte er gemerkt, daß da keine Nähe war. Er allein mit sich
bleiben würde. Erich. Sie hatten ein gutes Gespräch. Doch vielzuviel
Mißtrauen noch auf beiden Seiten. Das Konvikt habe ihn für die
Kirche versaut. Dieser Satz hängt noch nach. Mehr hatte Erich ihm
darüber noch nicht erzählen wollen. Daß Erich jetzt hier
kniet, dürfte Jeannes Schuld sein. Das dürfte Jeanne geschafft
haben.
Wie sie alles schafft. Daß sie weg
will. Von hier. Aus dem Dorf. Auch das. Wieder weniger Leute. Nur noch
die Alten bleiben. Wie die Orgel singt: vor allem die Höhen. Silbrig.
Sagen, was einem wirklich-im Kopf umgeht.
Die Predigt. Was hatte er sich Gedanken gemacht, dieser Hochzeit gerecht
zu werden! Über |
die Straße in ein anderes Land ...
Die Grenze. Mit ihr, auf ihr zu leben. Bilder dazu wie: die Misteln. Verworfen.
Die Kelter, an der die Hochzeitsgäste vorbeigegangen sind in seine
Kirche. Obst von beiden Seiten. In der Kelter ineins. Das Neue daraus:
der Most. Auch das verworfen. Ineins.
Zu einfach: weg mit den Grenzen. Und ohne
sie wäre dann alles gut. Zu leicht, eingängig zwar gut zu verdauen,
Kopfnicken, einsichtig für jeden, aber zu leicht wäre das. Aber,
und das ist ihm eingefallen, als er die Hochzeitsgemeinde geteilt in zwei
Seiten im Kirchenschiff sah, hinter der Braut die einen, die anderen hinter
dem Bräutigam, als liefe die Grenze auch hier, unsichtbar wie auf
der Straße, durch seine Kirche, zu einfach, alles ineins: Mann Frau,
Kinder Erwachsene, Schwarz Weiß, Kranke Gesunde, Gläubige Zweifler,
Priester und Laie, deutsch französisch, Bräutigam Braut.
Grenzen, überall Grenzen.
Und darüber hatte er sich gar keine
Gedanken gemacht. Das ist der Einfall. Was wäre am Einerlei, alles
ineins, der Gleichmacherei.
Mannweib, erwachsene Kinder, deutscher
Franzose, Grau in Grau. Dagegen: die Eigenheiten! Von Essen und Trinken,
der Art, sich zu geben, den Sprachen. Alles Besondere, das zu entdecken.
Nicht, der und der muß so sein wie ich, und wehe, wenn nicht. Im
anderen vor allem das Andere spüren, ohne Neid, die Angst, sich selbst
zu verlieren. |
Gewinn, nur Gewinn. Die Lust, zu suchen,
die Freude, zu finden, was einem noch nicht bekannt ist! Nicht der Einheitsbrei,
sondern die Würze, so etwas, so noch nirgends, noch nie geschmeckt.
In Achtung voreinander zu leben. Dabei nicht abzugrenzen, sondern mitzuteilen,
zu geben.
Mauern und Mauern.
Beides können sie sein: ausschließlich,
zu hoch, keiner kann mehr darüber, und werfen so lange Schatten, engen
ein, ersticken. Aber auch: zu niedrig, weht der Wind alles weg, da wächst
nichts mehr, nur noch der Stein. Das rechte Maß, das richtige Maß.
Aber, wo kämen da die Gottlosen hin,
was wäre das für eine Achtung der Bettelarmen vor den Steinreichen,
wie fänden sich Unglück und Glück!? Das Ende des Eingangsliedes.
Pastor Claude Vigy tritt an den Altar
und küßt ihn. Danach, weil auf seine Frage, was für eine
Messe sie wolle, Jeanne "feierlich" gesagt hatte, inzensiert er ihn: Festtagsweihrauch.
Feiertagsduft. Nach der Verehrung des Altars geht der Pastor mit den beiden
Ministranten zu den Sitzen. Er spricht: - Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des heiligen Geistes.
Nicht alle machen das Kreuzzeichen, sieht
er. Der Hochzeitsgemeinde zugewendet, breitet er die Hände aus und
begrüßt sie:
- Der Herr sei mit euch. |
Dünn die Antwort:
- Und mit deinem Geiste.
Dann sagt er:
- Heute feiern wir eine besondere Messe.
Ein Trauungsamt. Eine besondere Trauung. Schon lange ist so eine Trauung
in Leidingen nicht mehr gewesen. Ein Grund zur Freude.
Hebt er die Stimme:
- Und damit wir die heiligen Geheimnisse
in rechter Weise feiern können, wollen wir bekennen, daß wir
gesündigt haben.
Stille. Vor dem Sündenbekenntnis
die kurze Stille für die Besinnung.
Aus dem Kopf schlagen kann er sich das
dritte Thema nun schon für die Predigt. Aus dem Kopf. So gut die Anfänge,
Einfälle auch. Und dann, wenn er weiterdenkt, immer ins offene Ende.
Der Zweifel. Warum macht er es sich selber immer so schwer. Quält
sich zu sehr. Voller Skrupel Zerschlägt sich selbst die besten Gedanken,
hatte in einer Beurteilung über ihn im Seminar einmal gestanden. Wie
immer. Abgesichert. Nur keinen Fehler machen. Ausgehend von der Lesung,
im Bezug auf das Evangelium. Wie immer. Aber das Besondere, das würde,
wie schon so oft, in seinem Kopf bleiben. Die besten Gedanken ... Wo bleibt
seine Demut! Und er bricht die Stille und sagt
- Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen
Und da fast niemand mitbetet, lauter: |
- und allen Brüdern und Schwestern,
daß ich Gutes unterlassen und Böses getan habe - ich habe gesündigt
in Gedanken, Worten und Werken. Und er schlägt sich an seine Brust.
- Durch meine Schuld, durch meine Schuld,
durch meine große Schuld.
Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa,
wiederholt Philipp Hautz, der Lehrer, für sich. So hatte er es als
Ministrant gelernt. Sein Leben lang so gesagt. Ein halbes Jahrhundert ist
das schon her: wie sie auf den Knien lagen, in sich zusammengekrochen,
zusammengefaltet, die Stirn auf den Altarstufen fast. Und das Schuldbekenntnis
herunterbeteten. Auf Latein. Alle. Nicht nur die Gymnasiasten. Auch wenn
die anderen, denen sie, die auf die höhere Schule gingen, es beibringen
mußten, nicht genau wußten, was sie da herunterrasselten, oft
nur die Lippen bewegten, schnelles Gemurmel, das nur in einigen Worten
deutlicher wurde: omnibus sanctis et tibi pater, und mea culpa, und vor
allem am Schluß orare pro me ad dominum deum nostrum, damit der Priester
um Nachlaß, Vergebung und Verzeihung der Sünden bitten konnte.
Auch wenn es oft mehr Wettsprechen war als Gebet. Und die, denen sie oft
aus Spaß, aus Bosheit beigebracht hatten, das Latein, Deus meus zum
Beispiel, falsch auszusprechen, und die dann beim Abfragen es so aufsagten,
daß sie vom strengen Kaplan Kopfnüsse bekamen |
und nicht wußten, warum, wahrscheinlich
doch mehr vom Geheimnisvollen der Messe mitnahmen, etwas, das nicht so
war wie alles um sie herum, eine andere Welt, aufgehoben für diese
Zeit der bloße Alltag, als hier heute die beiden Meßknaben,
die das Schuldbekenntnis nicht mitbeten. Wahrscheinlich, weil es auf Deutsch
ist, sie es aber nur auf Französisch können. So daß Pastor
Claude Vigy es ohne sie mit einigen aus der Hochzeitsgemeinde aufsagen
muß.
Zu den bunten Gewändern des Priesters,
der Ministranten, dem geschmückten Altar, dem Weihrauch, der Orgelmusik,
dem ganzen Kirchenraum in seinem besonderen Licht gehört für
ihn das Latein. Introitus, Confiteor, Gloria, Credo, Agnus Dei, Ite missa
est. Was er noch weiß, noch im Kopf, im Gefühl hat. Für
ihn ist die katholische Messe lateinisch. Und wird sie bleiben. Das Geheimnisvolle.
Lachen würde da sein Sohn. Erich:
ja, das Geheimnisvolle, die Leute immer im Dunkeln lassen, sie einlullen,
ihnen die wahren Sorgen und Freuden verdecken, übertünchen, eingolden.
Erich. Vielleicht hat er nicht ganz Unrecht. Aber wieviel hilft es, wievielen
würde es helfen, alles ins rechte Licht gerückt, alles durchsichtig
zu machen, wie er immer sagt. Nein. Da gibt er Erich nicht zu. Dazu kann
er nicht ja sagen und Amen. Hier hat er wieder einen Beweis in der Hand,
ein Beispiel. |
| Ohne Latein ist die Messe für ihn
nur noch halbsoviel wert. Gut, wird Erich sagen, jetzt wissen die Leute
- wen immer er damit meint - jetzt wissen sie wenigstens, was sie nachbeten.
Und da fällt ihm die Entgegnung nicht schwer: das haben sie immer
gewußt. Die Leute. Was sie beten. Aber ärmer geworden ist für
ihn die katholische Kirche. Arm. Früher, überall, wo einer hinkam,
wie fremd es ihm da auch war, in der Meßfeier war er zuhaus. Da hörte
er ihm seit Kind auf vertraute Worte, Gesänge. Da sah er bekannte
Gesten. Da fühlte er sich nicht ganz allein. Und noch etwas könnte
er Erich erzählen, wenn er es nicht vergißt. Nur ein kleiner
Vorfall, vielleicht. Aber bezeichnend. Als während der Invasion der
Amerikaner im Zweiten Weltkrieg in einem Vorort der nahen Kleinstadt die
fremden Soldaten mit ihrer fremden Sprache den Einheimischen auf der Straße
gegenüberstanden, und Gesten reichten nicht hin, auszudrücken,
was gemacht, was sie wollten, da hatten sich die zwei Geistlichen, der
aus dem Ort und der Fremde, auf Latein unterhalten, war schnell eine Verbindung,
konnte vieles im Guten geregelt werden. Wozu ein Weltkrieg doch gut ist,
hört er Erich schon lachen. Mit Erich ist es oft schwierig. Oft unversöhnlich.
Hart. Wie sie sich auseinandersetzen. Oft nur ein kleiner Gedanke, nebensächlich,
ein Wort, unbedacht, und schon ist der Streit da. Immer kann er, der Vater,
nicht |
nachgeben. Nicht immer. Manchmal denkt
er sich, Erich ist noch sehr jung. Aber dann auch: wer hat je nach seiner
Jugend gefragt! Erich ist dreifig. Dreißig schon. Da hatte er, Philipp
Hautz, einen Krieg hinter sich. Die Gefangenschaft. Der Aufbau aus Trümmern.
Wie will - das kann er seinem Sohn nicht zum Vorwurf machen.
Ein Glück, daß Erich eine andere
Jugend hatte. Im Konvikt. Obgleich er da nicht sehr glücklich war,
nach dem, was er sagt. Fromm gewesen, genug für zwei Leben, sagt er.
Vielleicht auch deshalb Erichs Ablehnung
von allem, was "unkritisch" scheint. Die Kirche, die Messe, ist nicht der
einzige Anlaß für die häufigen Streitereien zwischen ihnen.
Daß Erich zurückgekommen ist aus der Großstadt, zwar nur
mit "einem Bein" in das Dorf, das andere hat er in der nahen Kleinstadt,
noch eine Wohnung, daß sein Sohn zurückgekommen ist, hat ihn
anfangs gefreut. Einer der wiederkommt. Aber dann, als er merkte, weshalb
er gekommen war und wozu, da hätte er ihn lieber wieder in der Großstadt
weit weg gesehen, ihn, wie vorher, einmal im Jahr dort besucht. Gut. Erich
als Journalist in der Lokalredaktion der Zeitung. Erich, wie er im Stadtarchiv
forscht. Erich, der sich in der Stadtbibliothek in die Heimatliteratur
vergräbt. Erich, mit dem Tonbandgerät im Dorf unterwegs. Erich,
und seine Freude, als er in der Bibliothek des Vaters eine |
| Sammlung von Büchern über die
Gegend entdeckt. Das hat ihm gefallen. Aber dann, schon beim Lesen von
Erichs erstem Artikel war ihm klar geworden, Erich wäre besser geblieben,
von wo er nachhaus gekommen war. "Aufdecken" nannte er das. Kritische Heimatkunde.
Hinterfragen. Aufarbeiten. Und seine Kolumne "Aus unserer Ecke" werde da
die Akzente setzen. Den Leuten ein kritisches Bewußtsein ihrer Herkunft,
ihrer Vergangenheit zu vermitteln. Und die anonymen Anrufe darauf, die
Drohbriefe bestätigen ihn nur noch darin. Auf faule Wurzeln gestoßen
zu sein. Den Sumpf trockenlegen. Da wimmle es immer noch nur so. Das habe
sich alles eingewintert gehabt. Jetzt, wo er die Decke wegzöge, da
mache sich das bemerkbar. Der Schoß sei fruchtbar noch ... Und ihre
Auseinandersetzung über "das" und "den Sumpf" und "die Vergangenheit"
und "das kritische Bewußtsein der Leute" war sehr hart geworden.
Auch er, sein Vater, habe vertuschen geholfen. Auch er sei da keine Ausnahme.
Auch er wolle doch nur die Scheiße vergolden, hatte ihm Erich gesagt.
So wütend hatte ihn das damals gemacht, daß er ihn laut wieder
weit weg gewünscht hatte, wo er hergekommen sei. Und Erich war wortlos
gegangen. Wochen danach hatten sie sich nicht mehr gesehen. Erich in seiner
Stadtwohnung. Abgeschottet. Stolz. Stur. Daß er, der Vater, den ersten
Schritt hatte machen müssen. Durch Jeanne. |
|