
Hauptseite

Projekte

Personen

Bilder

Hintergrund

Inhalt

Leidingen
Näheres über die Mistel
Alfred Gulden: Mistelzeit
Beschreibung,
Vorkommen,
medizinische
Wirkung
Die
Mistel aus Sicht
des
Gartenbaus
Die
Mistel in der
nordischen
Mythologie
Die
Mistel in der keltischen
Mythologie
(Druiden)

Straße in Leidingen
August 1939. In
den großen
Ferien Urlaub am Bodensee.
25. August: Teilmobilmachung
26. August: Abbruch des Urlaubs
und Heimfahrt.
Überall Truppensammlungen,
Truppentransporte. Die große Frage,
die uns alle bewegt: Krieg?
Zu Hause finde ich bereits
den Stellungsbefehl vor.
(Hans Neis, Ein Kriegstagebuch
1939/40)
(längerer Ausschnitt
in Kap. 5)
|
Die Leidinger Hochzeit
KAPITEL I
Diese Seite, die andere,
dazwischen das Niemandsland,
sagt der Lehrer.
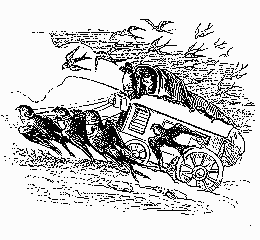
Wie die Landschaft sich schräg legt!
Da schmiert Gelb über Grün das nach Braun ins Weiß
zu Rot wieder ins Grün auf Gelb verwischen die Ränder ineinander
die Flächen nicht scharf mehr abzugrenzen die vielen verschiedenen
Grün zerlaufen sich in den Sonnenstreifen aus Wolkenrissen dunkeln
dann wieder ein verziehen die Formen biegen sich Linien weg vom Geraden
die Winkel springen runden sich Kanten die Ecken verzittern.
Aufgefangen.
Jetzt wieder:
Wiesen ... die Äcker ... die Wege ... der Bach ... die Bäume
... Rapsfelder ... das Dorf Dächer ... zwei Kirchen die Türme
... die Straßen ...
Pappelallee quert der Schlagbaum ...
zwei Autos:
crèmefarben, eher nach Weiß, das eine. Das andere ochsenblutrot.
Jeder Spritzer, der Dreck auf dem einen zu sehen. Das andere schluckt den.
Schon am Geräusch, sagen viele, sei das eine erkennbar, blind, weit
zu hören. Deutsch, deutscher Wagen. Die Straße immer fest im
Visier. Guter Stern. Das andere springt mit dem Löwen. Ochsenblutrot.
Französisch. Aber, sicher ist nicht, ob in dem einen, dem deutschen,
auch Deutsche sitzen. Auch nicht, daß in dem anderen Franzosen sein
müssen. Denn es gibt den einen Wagen auch da und den anderen hier.
Franzosen hinter dem guten Stern, |
die Straße fest im Visier, im sauberen Weiß mit dem leicht
und weit erkennbaren Geräusch im Ohr. Aber auch Deutsche, die mit
dem Löwen springen, im Ochsenblutrot, das den Dreck schluckt, jeden
Spritzer. Und wenn auch das eine jetzt hier auf deutscher Seite fährt,
es könnten Franzosen sitzen in ihm. Und auf der anderen Seite in dem
anderen Deutsche. Da würde das Nummernschild entscheiden, vielleicht,
wem und woher. Aber so, wie es jetzt aussieht hier, fährt das eine,
crèmefarben, eher nach Weiß, kein Spritzer noch Dreck, sondern
frischgewaschen, gewachst, auf deutscher Seite mit Deutschen. Das andere,
ochsenblutrot mit dem Löwen, französisch, Franzosen. Deutlich
getrennt vom Zollbaum fahren sie auf Straßen beiderseits des Baches
der Grenze entlang vorbei an den Bäumen voll von Misteln:
Baum auf dem Baum, jahrüber grün, auch winters, Weihnachtsfest,
die Deutschen: "Wie grün deine Blätter sind", von wegen, - hier
stimmt es. Immergrün, so wie die Liebe, die keinen Winter kennt, -
ja, das könnte ein Anfang sein. Auch wenn Theophrast schon weiß,
daß nicht die Götter sie über die Bäume streuen, sondern
die Vögel sie pflanzen auf ihre eigene Weise - was macht das?
Denn auch Vergil, - Vergil!, er gibt dem Äneas sie mit als Schlüssel
zur Unterwelt. Was für ein Bild: Immergrün der Schlüssel
zur Unterwelt. Hier aber |
leider nicht brauchbar. Um das Gegenteil geht es ja, um das Leben,
die Liebe. Baum auf dem Baum ... Einer trage des anderen Last - ein gutes
Gleichnis. Das nach dem Anfang mit Immergrün und der Liebe, die kennt
keinen Winter, einer trage des anderen Last. Das Bild prägt sich ein,
hält, das hat Widerhaken, bleibt hängen.
Und er klatscht mit der Faust in die Hand, der Pastor, und will schon
auf und ins Haus zu Notizbuch und Stift, da hält ihn die Sonne, die
ihm auf den Rücken scheint und ihm die Schmerzen nimmt für Momente.
Er sitzt, runder Rücken, vor seiner Kirche auf einer Kelter, dem Sandsteinsockel
mit Rinne. Die Kelter, nicht mehr im Gebrauch, hat er von Bauern herschaffen
lassen hier auf den Platz vor der Kirche. Die Baskenmütze tief in
die Augen, die spitze Nase zackt vor, kranker Rabe, die Arme baumeln lang
über die Soutane, sieht er vom Kirchenhügel weit über die
Wiesen zum Bach in die Bäume am Straßensaum und dort die Misteln.
Und, um im Bild zu bleiben, könnte er auch noch nach immergrünender
Liebe und Baum auf dem Baum, trage des anderen Last, die Mistel, geflochten
im Brautkranz, als Versprechen für reichen Kindersegen anknüpfen,
Glück für die Braut:
Die lehnt am Fensterbrett, hinter der Gardine, im Wohnzimmer. Früher
durften sie nur an Feiertagen |
hinein. Die gute Stube. Mit einem eigenen Geruch. Der änderte
sich: Weihnachten, Kindtaufe, Kommunion, einmal beim Leichenschmaus. Da
wurde vorher entstaubt, gelüftet, beheizt. Jetzt, jeden Abend sitzen
sie alle vor dem Apparat, ist das Zimmer auch zwischen den Festen bewohnt.
Nur noch eine gewöhnliche Stube. Nur noch aus der Erinnerung:
der Geruch nach getrockneten Apfelschnitzen, der sichere Ort für
die Geschenke vor Weihnachten, die mit Landschaften bestickten Kissen auf
dem Sofa, Lichtspiele durch die Häkelmuster der alten Gardinen ...
Früher, früher, jetzt aber ...
Angst soll sie haben. Hat sie aber nicht. Auch wenn sie versucht haben,
es ihr einzureden. Angst wovor? Daß sie sich heute "ewig" bindet?
Weg geht von zuhause? Über die Straße in ein anderes Land? Angst
hat sie früher oft gehabt. Die hatten sie ihr nicht einreden müssen.
Angst, wenn sie auf die Straße ging. Angst, in den Spiegel zu schauen.
Sie hat immer ihr sommersprossenübersätes Gesicht gehaßt,
die roten Haare. Die Schimpfverse sind ihr noch wie neu.
Die hat sie nicht vergessen können. Der Bruder, der sie immer,
wenn Streit zwischen ihnen war, und das war oft, Karottenkopf nannte, oder
auch, wenn der Streit besonders heftig war, und der Bruder sich nicht mehr
zu helfen gewußt, sie zu schlagen |
sich aber nicht mehr getraut hatte, sie rotes Luder, du rotes Luder,
gerufen hatte.
Manchmal nachts hatte sie es sich vorgesagt,
Fremdwort, Beschwörung, Zauberformel:
rotes Luder, du rotes Luder,
aber es hatte sie nicht erlöst.
Und einmal hat die Mutter, so etwas geht einem nicht aus dem Kopf,
das sitzt zu tief, festgefressen, hat die Mutter sie des Teufels genannt,
Hexe, du Satansbrut.
Daß in den Schimpfversen der Kinder auf der Straße so etwas
vorkam:
sind des Teufels Artgenossen,
rote Haare Sommersprossen!,
hatte sie nicht begreifen können, es aber hingenommen. Aber die
Mutter, das hat sie nicht vergessen:
des Teufels, Hexe, du Satansbrut,
wie die Mutter das schrie, das hat sie noch immer im Kopf.
Aber für so etwas ist heute kein Tag.
Und die Braut schaut auf die Straße, wo, schon im "guten", dem
Festtagskleidchen, rosa mit Volants, ein kleines Mädchen kniet.
Mit Kreide zieht es Linien. Leiter, Kreuz, Kopf: den Häuschenmann
zum drauf-, drüber-, drinhüpfen. Quer über die Straße.
Fertig. Die Kreide weg in den Blumenkübel neben der Haustür.
Das ist ihr Versteck. Auch für den Hüpfstein, flach, |
lange ausgesucht unten am Bach. Wurf. Ins erste Kästchen,
das Leiterviereck, getroffen, überhüpft, ins Kreuz gegrätscht,
dann in den Kopf, sich umgedreht und zurück. Da schlägt die Glocke:
dreimal kurz. Dreiviertel. Und der Lehrer greift weit aus mit dem linken
Arm, daß sich der Jackenärmel hochschiebt und die Uhr freigibt.
Dreiviertel. Jetzt müßte ... jetzt. Da schlägt es wieder
dreimal kurz. Nur mit einem anderen Klang. Sieben Sekunden, keine mehr
noch weniger. Und der Lehrer schüttelt den Kopf. Sieben Sekunden!
Und das seit Jahren. Die Kirchturmuhr auf dieser, der deutschen Seite,
sieben Sekunden vor der auf der französischen Seite. Verrückte
Zeit! Dabei, sie könnten seelenruhig miteinander schlagen, die beiden
Kirchturmuhren. Sind sie doch klanglich aufeinander abgestimmt worden von
einem Spezialisten, von weither eigens dafür hergeholt und hoch bezahlt,
daß es zu keinen Dissonanzen kommt.
Und er wirft mit einer Geste, die alle seine ehemaligen Schüler
kennen, die weiße Haarsträhne, die ihm beim Kopfschütteln
ins Auge fällt, zurück.
Wie feinfühlig sie auf beiden Seiten geworden sind, die da etwas
zu sagen haben, wie hellhörig! Auf einmal. Wären sie das damals
gewesen! Und er klopft auf einen Stapel alter, ins Grau vergilbter Schulhefte,
blättert darin, schließt das Heft, auf |
dessen Umschlag ein Schildchen mit steiler Schrift "Kriegstagebuch
1939 - 1940" klebt.
Wieder die Geste, die aber diesmal keine Strähne aus dem Auge
wischt, sondern über die Haare den Kopf nachzieht.
Und er nimmt vom Tisch das Brillenetui. Die Brille hat er erst seit
kurzem. Noch ungewohnt. Über den Tisch mit den vergilbten Schulheften,
Kriegstagebuch, - daraus will er vorlesen heute, wenn alle da sind zur
Hochzeit - schaut er aus dem Fenster auf die Straße, auf der das
Mädchen hüpft.
Ruhe und Frieden.
Das weiße Pferd, hinter der Kirche, der dieser Seite, aus der
Wiese gewachsen. Nichts verrät, daß es lebt. Regungslos. Wie
lange steht es schon so da, setzt alles um es herum zu sich in Beziehung:
die umlaufenden Mauern - Urmeer, Muschelkalkboden - aus gelbweißen
Steinen, eingeschlossen darin die Kopffüßler seit Zeiten, die
Misteln, das Himmelsblau aus den Wolkenlöchern, die Gräser und
Wiesenblumen ...
Stille.
Dem Pferd das Träumen.
Plötzlich: ein Zittern läuft ihm über die Flanken, es
stellt die Ohren auf, und hebt im Ruck den Kopf: Der Ton, eine Stimme,
da singt wer vom Bach her. Wo neben der Straße, die auf der deutschen
Seite den Bach entlang läuft, auf dem Seitenstreifen ein |
Wägelchen steht. Handwagen, Ziehwagen. Aber nicht der Sack mit
Kartoffeln, Holz, Briketts, der Wäschekorb oder Obst sind darin, sondern
neben den Kasten mit Bier sind ein Gitarren-, ein Akkordeon- und ein Geigenkasten
gequetscht. Ohne Hülle liegt quer über dem Wägelchen noch
ein Instrument: gelbes Eisenrohr wie ein Besenstiel lang, Töpfe daran
geschweißt, Stahlseiten darüber gespannt, mehrere Deckel, locker
geschraubt, Hupen, Klingeln und Schellen, und obenauf steckt ein Teufelskopf.
Die drei Musikanten sitzen nicht weit davon und trinken Bier:
- Komm heraus, komm heraus, du traurige Braut,
heut hast sollen werden ein höllisch Bärenhaut.
Heut trägst ein Bändchen um den Hals,
übers Jahr hast weder Speck noch Schmalz!
In der Küche die Haushälterin, hager, hochaufgeschossen,
die Haare streng zurück in einen Knoten, was das Gesicht noch kantiger
macht, mit einer Kittelschürze, weiß, noch ohne Flecken, steht
sie da neben dem Bräutigam und zeigt ihm, daß alles bestens
ist, vorbereitet.
Auf dem Ofen der große Topf mit der Rindfleischsuppe, die vor
sich hin kocht. Sie hebt den Deckel vom Topf mit dem Sauerkraut. Knoblauch,
Zwiebeln, Lorbeerblatt, Wacholderbeeren und zum Schluß das Schinkenfett
werden ihm die Würze geben. Gestern schon gemacht, daß sie |
über Nacht trocknen, abgezählt, pro Hochzeitsgast vier, auf
der großen Platte aufgereiht wie nach der Schnur, liegen die Markklößchen.
Wie aus dem gekochten Schinken, der ist noch im Stück, das Fett auf
das Untersatzbrett quillt, als die Haushälterin mit dem Finger die
Schwarte drückt! Von einem der langen Weißbrote, die, noch nicht
in die Brotkörbe geschnitten, auf dem Küchentisch liegen, bricht
sich der Bräutigam ein Stück, belegt es mit rohem Schinken. Auch
unter den Küchentisch schaut er, wo, in Eimern mit Wasser, die schon
geschälten Kartoffeln schwimmen. Sie bleiben bei dem Seitentisch stehen,
auf dem in Glasschüsseln die Salate schon vorbereitet sind. Der Schnittlauchsalat,
vermischt mit kleingeschnittenen Eiern, gibt dem Karottensalat Kontrast,
der Selleriesalat den süß-sauren Zwetschgen, die Silberzwiebeln
den eingemachten Gurken. Zum Heißen das Kalte, die Salate zum Rindfleisch,
und zum Kalten das Heiße, zum Schinken Gemüse, sagt die Haushälterin,
als sie an den Schüsseln mit Bohnen, Spargel, Erbsen und Blumenkohl
vorbei über den Gang in den großen Raum treten, in dem die Hochzeitstafel
gedeckt ist.
Um jedes Gedeck liegt nicht nur ein Blumenkranz, auch ein Kärtchen
mit Namen und Spruch, auf den jeweiligen Hochzeitsgast ein wenig abgestimmt,
steht dabei. |
Was wahr ist beim Licht der Lampe,
ist nicht immer wahr beim Licht der Sonne.
Lange hatten sie, die Braut und er, überlegt, was sie auf das
Kärtchen des Paten, Fotograf, ein Spitzfindiger, ironischer, oft Zyniker
auch, schreiben könnten.
Dieser Spruch, hatte der Bräutigam gefunden, könnte ihm gefallen,
seinem Paten:
Der jetzt mit Frau und Tochter aus dem deutschen Linienbus steigt.
Die Haltestelle aus Eternitplatten als Unterschlupf gegen Regen. Noch ein
Stück bis zum Dorf.
Der Fotograf betrachtet die Zeichnungen auf dem Eternit, während
seine Frau schon auf dem Weg ins Dorf ist, und die Tochter zwischen Mutter
und Vater zögert. Schließlich geht sie zum Vater, der, den Fotoapparat
am Auge, vor den Zeichnungen steht. Pornografitti, sagt er, Dorfporno.
Und drückt ab. Während das Sofortbild aus dem Apparat rutscht
und Farben und Formen annimmt, stellt die Tochter vor den Zeichnungen eine
Illustriertenpose nach: die Hände hinter dem Kopf, den Mund wie zum
Kuß, die Augen halboffen.
Der Fotograf lacht, tritt zurück, zieht die Schärfe nach,
da kommt seine Frau. Schon ehe sie da ist, hat sie die Sätze: ob es
nicht genüge, daß ihre Tochter wie eine Motorradschickse, Ballettschuhe,
Minirock, Lederjacke, Rattenkopf, verschminkt |
zu der Hochzeit gehe, müsse er, er sei doch alt genug, der eigene
Vater, die Tochter auch noch so, sagt sie aber nicht, sondern sagt: originell
ist das nicht. Da gibt es hier doch wirklich anderes zu sehen. Da vorne
die alte Mühle, oder hier, hier, sie zeigt über sich in die Wolken,
den Bussard:
Der hoch über dem Dorf ruhige Kreise zieht. Die Schwingen gespannt,
nutzt er den geringsten Lufthauch und die thermischen Strömungen.
Keine Bewegung der Flügel, Ruderflug oder Rütteln, kreist er,
nicht über Freiland, sondern über den Dächern, hat, jetzt
tiefer, Spirale nach unten, besser zu sehen, keinen Schnabel, stößt
kein Hiäh! aus, ist ohne Fänge, nicht braun gefleckt die Unterseite,
kahl, glatt, keine Federdecke, starre Tragflächen, nicht gezackt an
den Enden, ein Segelflugzeug, das jetzt abdreht in Richtung Wiesen, den
Bach, der die Wiesen scheitelt, die beiden Straßen auseinanderhält:
Auf denen, wie nach Absprache, auf geheimes Kommando, so, als werde
die Flagge mit den schwarzen Karos geschwenkt, der Start freigegeben, crèmefarben,
eher nach Weiß, guter Stern, auf der einen, ochsenblutrot mit dem
Löwen auf der anderen, jetzt die beiden Autos losjagen, als gelte
es, welchen Preis zu gewinnen, was zu beweisen, heulen sie los, als seien
die beiden Fahrbahnen nicht holprig, voller Schlaglöcher vom Winter
noch, unübersichtlich die Kurven, ginge es nicht |
auf und ab, sandiger Seitenstreifen, sondern ausgebaut nach Berechnung,
gesicherte Rennstrecken, Nürburgring und Le Mans, und nicht zwei Landstraßen
auf Leidingen zu, werden sie schneller, nur noch auf der Fahrbahnmitte,
wenn jetzt der Linienbus entgegenkäme oder ein Traktor!, schießen
sie an den Bäumen vorbei, die rücken enger: Immergrün,
Wintergrün,
Kreuzholz,
Alpranke,
Alfranke,
Vogelkraut,
Hexenkraut,
Hexenbesen,
Donnerbesen,
Baum mit Doppelgestalt, Gabelzweig des Merkur, magischer Zweig der
Persepone, wehrt Zauber ab und böse Geister, feit gegen Blitz und
Brand, kann Schmerzen lindern, Kranke heilen, Schätze finden helfen,
alle Wünsche würden sich erfüllen ...
Wieviele Namen, welcher Zuspruch, dreht es sich dem Pastor im Kopf,
daß er die Hände darüber zusammenschlägt. Mehr als
für nur eine Predigt wäre das Stoff. Immergrün, ewige Liebe,
trage des anderen Last, Heilpflanze, Glückspflanze und - Zauberpflanze.
Zauberpflanze! Das dämpft die Begeisterung, verschlägt ihm den
Spaß. Gut, er ist |
Humanist, kennt die Griechen, die Römer. Ist es nicht Plinius,
der schreibt, wie die Gallier diese Pflanze verehren im Kult:
daß sie nach Neumond am sechsten Tag zwei weiße Stiere,
die Hörner geschmückt, herbeiführen, die Druiden dann in
weißen Gewändern den Baum ersteigen, mit goldener Sichel die
Misteln abschneiden und, daß diese nicht die unheilige Erde berühren,
in schwarzen Tüchern auffangen ...
Einerseits, sagt sich der Pastor, die Gallier, das würde treffen.
Hier auf der französischen Seite. Nebeneffekt für die Trauung.
Die, der wichtigere Teil der Hochzeit, das hat die Braut durchgesetzt,
in seiner Kirche, von ihm, gehalten wird. Wenn er auch zugeben mußte,
auf Deutsch, da das alle verstünden - gern macht er das nicht, hier
ist Frankreich - und die Braut, daß das Hochzeitsessen, ganz gegen
den Brauch, im Haus des Bräutigams ist. Auf deutscher Seite.
Andererseits, in einer christlichen Kirche, Humanist hin oder her,
Heidnisches zum Gleichnis zu nehmen, das ginge wahrscheinlich zu weit.
Außerdem, der Baum auf dem Baum - von wegen einer trage des anderen
Last! Schmarotzer, Schmarotzer! Und, hier läßt er endgültig
die Mistel fallen als Thema für seine Hochzeitspredigt, saugt sie
nicht dem Baum die Lebenskraft aus, seine Säfte? Und wer wäre
hier was in dem Gleichnis, der Bräutigam, die Braut: |
Betrachtet noch immer das Mädchen im rosa Kleidchen mit den Volants,
das den Häuschenmann abhüpft ...
Später, kein Kind mehr, schon aus der Schule, als die Spottverse
"Karottenkopf, des Teufels Artgenossen" nicht mehr so oft, so direkt kamen,
sie auch nicht mehr so trafen, fingen die anderen Kränkungen an. Beim
abendlichen Treffen an der Bank neben der Telefonzelle. Bemerkungen, nur
nebenbei, aber das Lachen dazu, auch der anderen Mädchen: die Rothaarigen,
wie feurig, so gut im Heu, leicht zu bekommen. Und sie die Gräben
in sich noch breiter machte. Keinen nahe heranließ. Die Treffen dann
auch mied. Sie sei jetzt wohl zu fein, weil sie in der nahen Kleinstadt,
auf deutscher Seite, eine Lehre begonnen hatte, Städterin, wohl zu
gut für die aus dem Dorf.
Und die Braut lacht.
Der, den sie heute heiraten wird, ist aus dem Dorf. Von der anderen
Seite. Nur über die Straße. Der Sohn des Lehrers. Das hätte
sie sich auch nicht gedacht, damals als kleines Mädchen:
Das jetzt, den Hüpfstein auf dem Kopf, vor dem Häuschenmann
steht. Anhebt zu hüpfen: ein Auto! Und es fängt den Hüpfstein
auf und springt zum Straßenrand. Ein grauer VW-Bus kommt langsam
näher, fährt dem Häuschenmann quer über den Bauch,
teilt ihn mit lehmigen Reifen in Kopf und Bauch und Fuß, zieht weiter
die Lehmspur |
hinter sich her durch die Straße.
Das Mädchen hat jetzt die Kreide dabei. Zieht die Linien nach.
Macht den Häuschenmann wieder ganz. Behält die Kreide fest in
der einen, mit der anderen Hand den Hüpfstein vorsichtig auf den Kopf
gelegt, hüpft es die Leiter, das Kreuz, den Kopf, dreht sich: da,
das Auto! Hinter dem Ort gewendet, aus dem Feldweg kommt der graue VW-Bus,
wieder mit Lehm auf den Reifen. Das Mädchen springt auf die Seite,
ihr der Hüpfstein vom Kopf. Und wieder der Häuschenmann auseinander.
Das Mädchen zieht über die lehmigen Streifen die Linien, ihren
Häuschenmann, nach. Der graue VW-Bus läßt seine Spur, drittelt
die Straße.
- Diese Seite, die andere, dazwischen das Niemandsland,
sagt der Lehrer und schaut dem grauen Zollauto nach.
Eine Straße, zwei Namen.
"Neutrale Straße" auf dieser, "Grenzstraße" auf der anderen
Seite.
Zweimal der Bäcker, hier dort, der Briefträger, der Schulbus.
Das Zollauto für die eine, die andere Seite. Ein Dorf, drei Sprachen.
Zwei trennen, eine verbindet.
Zwei Kirchen. Zwei Zeiten die Kirchturmuhren.
Und er schüttelt den Kopf und will mit seiner gewohnten |
Geste die Strähne aus dem Auge, da vergißt er die Brille,
wischt sie mit den Haaren zurück.
- Das gäbe Scherben,
sagt der Bräutigam, das Tablett mit den Schnapsgläsern für
den Umtrunk auf einer Hand balancierend.
Die Haushälterin lacht:
- Scherben, Scherben, die bringen Glück!
Das hat das crèmefarbene Auto, kein Spritzer noch Dreck, guter
Stern, das dem ochsenblutroten Löwen davonzieht, jetzt aus der Kurve,
Seitenstreifen, der Sand stiebt, das Wägelchen der Musikanten rutscht
weg, kippt in die Wiese Bierkasten und Instrumente, der Sänger:
- Heut trägst ein Kränzchen auf dem Kopf,
übers Jahr hast du die Haare ausgeropft!
bricht ab, aber das Auto fängt sich, trifft wieder die Straße,
verliert nicht das Tempo, rast weiter auf das Dorf zu, jetzt mit dem Löwen
auf gleicher Höhe:
Sieht sie der Pastor:
- Die Wahnsinnigen!
Und springt von der Kelter. - Die Kelter! Auf dem Gleichnis gesessen
die ganze Zeit! Die Kelter! Was für ein Bild! Das Obst, das auf beiden
Seiten wächst, reift, zusammenkommt in die Kelter, gepreßt wird,
im Faß etwas Neues, der Most. So ein Gleichnis! Und er eilt zu Notizbuch
und Stift, |
vergessen die Wahnsinnigen, crèmefarben, ochsenblutrot, guter
Stern, der Löwe, die auf den beiden getrennten Straßen - erst
im Dorf werden sie zu der einen mit den zwei Namen - dahinjagen, Vorteil
jetzt für den Löwen, vor sich nur noch die Gerade, während
der gute Stern in das Dorf, die letzte Kurve einbiegt, zwischen die Häuser,
rettet sich der Fotograf, Frau und Tochter am Arm, in die Hausecke, um
die jetzt das crèmefarbene schießt auf das ochsenblutrote
zu, da kreischen die Bremsen, wiehert das Pferd, schneidet die Haushälterin
sich in den Finger, der Bräutigam läßt das Tablett mit
den Gläsern fallen zu Scherben, schreit die Braut auf: Heilige Jungfrau!,
das Mädchen mitten auf der Straße im Häuschenmann!, hat
der Lehrer seine Brille vom Boden, wieder auf, sieht die beiden Autos,
crèmefarben ochsenblutrot in die Seite, davor das Mädchen,
er erwartet den dumpfen Schlag, Knall, der kommt, reibt Ochsenblutrot in
das Weiß, drückt den guten Stern in den Löwen zum Halt
vor dem Mädchen.
- Das fängt gut an, die Hochzeit!
Sagt er. |
|
